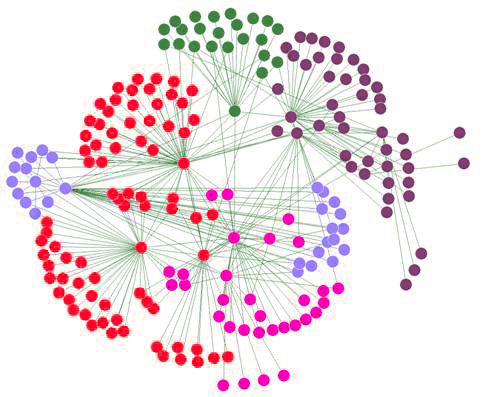 |
| Bildquelle: Wikipedia |
Enterprise 2.0 – Transparenz,
Offenheit und Vernetzung
Wie kann man den Esprit,
Unternehmergeist sowie die Flexibilität, Dynamik, Leistungsbereitschaft und
Motivation eines kleinen, jungen Start-Ups in ein Unternehmen zurück bringen?
Eine vielversprechende Lösungsidee heißt Enterprise 2.0. Der Begriff geht auf
den Harvard-Professor McAfee zurück und bezeichnet den Einsatz von Social
Software wie Wikis, Blogs, Foren etc. zur Projektkoordination, zum Wissensmanagement
und zur Innen- und Außenkommunikation in Unternehmen.
Der Einsatz von Social Software in
Unternehmen ermöglicht einen verbesserten Zugang zu Informationen und Wissen,
indem eine Vielzahl an Benutzern eigene Inhalte publizieren und diese durch
Suchmöglichkeiten mit geringem Aufwand wieder auffindbar sind. So werden etwa
Lösungen zu Problemen in Wikis, Foren oder Blogs dokumentiert und können später
von anderen Mitarbeitern aufgerufen werden. Produktivität und Teamperformance
können ebenfalls erhöht werden, da Social Software die Kommunikation über
räumliche und zeitliche Barrieren hinweg ermöglicht und dabei gleichzeitig die
Zusammenarbeit und Innovationsfähigkeit von Teams erhöht. Mitarbeiter können so
situativ standort- und hierarchieübergreifend vernetzt werden, indem sie z.B.
in Projekt- oder Themengruppen per Blog und Forum jederzeit Inhalte erstellen,
Feedback geben und Lösungen vorschlagen können.
Ein Beispiel auf einfachster Ebene
ist eine Powerpoint-Präsentation: In einem Enterprise 2.0 sind keine Massen von
Mails mit riesigen Dateianhängen und Verwirrung darüber, wer gerade die
aktuellste Version hat, nötig. Social Software ermöglicht es, die Präsentation
in einem virtuellen Teamraum abzulegen und dort in Foren die Inhalte und Veränderungen
zu besprechen. Je komplexer die Aufgabe ist, desto nützlicher kann die Nutzung
von sozialer Software sein.
Das Konzept Enterprise 2.0 erfordert
jedoch bisweilen weitreichende Veränderungen – v.a. in der Unternehmenskultur
und der Unternehmensführung. Manager müssen anders führen, damit Mitarbeiter
selbstorganisierter arbeiten können. Sie dürfen sich nicht fragen, ob ihre
Meinung überhaupt gefragt ist oder sich ihr Chef oder ihre Kollegen über
kritische Beiträge ärgern. Führungskräfte sorgen sich hingegen erfahrungsgemäß eher
um veränderte Machtstrukturen, da sie ihre Herrschaft über Wissen und Verfahren
nicht in unerheblichem Maße aufgeben, wenn sie sich in einem Enterprise 2.0 nun
einer offenen Kommunikation auf der Plattform stellen müssen.
Die Prinzipien von Enterprise 2.0
lauten Transparenz, Offenheit und Vernetzung. "Die Vorbildfunktion der
Geschäftsführung oder des direkten Vorgesetzten, die sich aktiv im internen
Netz bewegen, ist extrem wichtig. Mitarbeiter müssen erleben, dass ihre Beteiligung
nicht nur erlaubt, sondern hoch erwünscht ist, sonst funktioniert das interne
Web nicht als Wissensspeicher und Tauschbörse", meint Professorin Andrea
Back von der Universität St. Gallen.
Social Software ist jedoch nur so
gut wie die Anwender, die sie benutzen. Erst über die erfolgreiche Bedienung
entfaltet sie ihr vollständiges Potenzial für das Unternehmen. Bei der
Einführung kommt es darauf an, nicht nur eine kleine Gruppe an Führungskräften
für die richtige Nutzung der Plattform fit zu machen. Das Leitmotiv muss sein,
mit der ganzen Mannschaft ans Ziel zu gelangen. Für eine erfolgreiche
Enterprise-2.0-Implementierung reicht es also nicht aus, die Software nur
einzuführen. Es bedarf eines guten Projekt- und Veränderungsmanagements, um
alle mitzunehmen. Auch in Zeiten von Medien und Technik macht eben doch der
Mensch den Unterschied.




